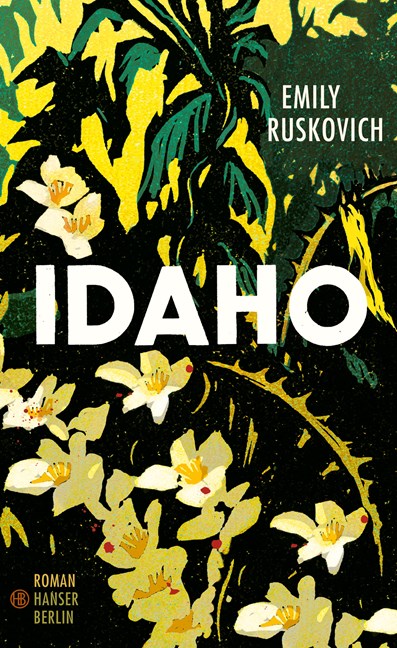 In vielerlei Hinsicht ist Emily Ruskovichs Debütroman „Idaho“ voller Überfluss, wie die blühenden Büsche auf dem Cover. Die Berglandschaft von Idaho, die Erzählzeit, die mehr als 50 Jahre umfasst, jedoch ohne Anspruch auf Chronologie, die Figuren, von denen, wenn man denkt, man hätte sie alle kennengelernt, immer noch welche auftauchen, die näher beleuchtet werden. Davon gibt es mehr als genug in „Idaho“, manchmal fast schon zu viel. Im klaren Kontrast dazu steht die Suche nach Antworten, mit ihnen geht Emily Ruskovich äußerst sparsam um. „Idaho“ ist eine Geschichte der offenen Fragen. Das ist auf eine Art irritierend, da es hier genug Stoff gäbe für eine Thriller-artige Entwicklung. Aber auch gerade darin liegt der Reiz dieses erstaunlichen Debüts. Denn an Überraschungen mangelt es in „Idaho“ trotzdem nicht. Kindstötung, Frühdemenz, die Liebe und das Leben in den unwirtlichen Bergen Idahos sind nur ein paar der Themen um die es hier geht.
In vielerlei Hinsicht ist Emily Ruskovichs Debütroman „Idaho“ voller Überfluss, wie die blühenden Büsche auf dem Cover. Die Berglandschaft von Idaho, die Erzählzeit, die mehr als 50 Jahre umfasst, jedoch ohne Anspruch auf Chronologie, die Figuren, von denen, wenn man denkt, man hätte sie alle kennengelernt, immer noch welche auftauchen, die näher beleuchtet werden. Davon gibt es mehr als genug in „Idaho“, manchmal fast schon zu viel. Im klaren Kontrast dazu steht die Suche nach Antworten, mit ihnen geht Emily Ruskovich äußerst sparsam um. „Idaho“ ist eine Geschichte der offenen Fragen. Das ist auf eine Art irritierend, da es hier genug Stoff gäbe für eine Thriller-artige Entwicklung. Aber auch gerade darin liegt der Reiz dieses erstaunlichen Debüts. Denn an Überraschungen mangelt es in „Idaho“ trotzdem nicht. Kindstötung, Frühdemenz, die Liebe und das Leben in den unwirtlichen Bergen Idahos sind nur ein paar der Themen um die es hier geht.
Da haben wir Jenny und Wade, ein junges Paar, das ein Haus in der Abgeschiedenheit der Berge Idahos bezieht. Wie abgeschieden sie tatsächlich leben, erfahren sie in ihrem ersten Winter, als sich herausstellt, dass die Wege entgegen der Aussage des Grundstücksverkäufers nicht geräumt werden. Jenny ist schwanger und sie sitzen fest in einem leeren Haus, denn auch der Umzugswagen hat den Weg nicht mehr vor Wintereinbruch geschafft. Wade verbringt den Winter damit, einen Hubschrauberlandeplatz im Wald zu roden, Jenny sortiert die Unterlagen von Wades verstorbenen Vater, der Inhalt der einzigen Kisten, die sich im Haus befinden. Aber der Frühling kommt rechtzeitig und mit ihm das erste Kind June, später das zweite Mädchen May. Es scheint ein idyllisches Leben in der Abgeschiedenheit der Natur, geprägt von Streit und Liebe im ausgeglichenen Maße. Bis eines Tages eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes die Familie zerreißt. Kinder und Eltern in einem Pick-Up unterwegs im Wald, die Ladefläche voll Brennholz, eine Axt in Jennys Hand. Am Ende dieses Tages ist May tot und June verschwunden.
Es geht auch um Ann und Wade. Ann war Junes Lehrerin und hat Wade Klavierunterricht gegeben. Wades Vater und sein Großvater haben beide an Frühdemenz gelitten, Wade fürchtet die Krankheit auch bei sich und hat gehört, Klavierunterricht könne Gutes bewirken. Neun Jahre nach dem schicksalshaften Tag, der Wades und Jennys altes Leben auf immer beendet hat, leben Ann und Wade als Mann und Frau in dem Haus auf dem Berg. „Ich könnte mich um dich kümmern“, hat Ann zu ihm gesagt, als er nach dem Unterricht die ersten Anzeichen der Krankheit zeigte. Sie erträgt seine Anfälle von Aggression, akzeptiert seine Unfähigkeit über das Geschehene zu sprechen, versucht aber auf ihre Weise, die Ereignisse zu rekonstruieren. Immer wieder findet sie Puzzlestücke aus der Vergangenheit, ein unter den Schrank gerutschtes Polaroid von May, ein von Jenny gezeichnetes Portrait. Die Vorstellung, dass alles irgendwann dem großen Vergessen anheim fällt, erschreckt Ann. June wurde nie gefunden. Ebenso wenig wird sie jemals erfahren, was genau an jenem Tag in dem Pick-Up passiert ist.
Und nicht zuletzt ist da Jenny. Jenny, die wir als Mutter kennenlernen, fürsorglich und bemüht, und als Gefängnisinsassin, wie sie langsam eine Beziehung zu ihrer Zellengenossin Elizabeth aufbaut. Vor Gericht hat sie sich schuldig bekannt und sitzt eine lebenslange Haftstrafe ab. Auf Begnadigung hofft sie nicht, ihr Recht auf Gnade sieht sie als verwirkt an.
Die einzelnen Handlungsstränge sind ineinander verschachtelt, Emily Ruskovich springt von einer Person zur nächsten, von einer Zeit zur anderen. Die Geschichte geht zurück bis in die Siebziger, zu Wades Jugend, sie erzählt wie Jenny und Wade sich kennenlernen bis hin zu dem Punkt, an dem Jenny und Ann sich schließlich begegnen. Auf diese Weise schafft sie von jeder einzelnen Figur ein rundes Bild, verzichtet aber wie gesagt darauf, entscheidende Fragen zu beantworten. Eine detaillierte Beschreibung dessen, was an jenem Tag Grauenvolles passiert ist, erhalten wir nicht, ebenso wenig wird die Frage nach dem Motiv geklärt. Und noch so einiges anderes bleibt im Dunkeln. Aber genau das trägt auch zu der Schärfe von Emily Ruskovichs Debüt bei. So wird es noch unmittelbarer, eine Momentaufnahme aus dem Leben, in dem sich auch nicht immer alles erklärt oder auflöst. Erzählerisch ist nichts hier zufällig, Fäden werden gesponnen und später wieder aufgenommen. Das ist überaus kunstvoll, manchmal fast ein wenig zu viel des Guten, wie zum Beispiel wenn einem ehemaligen Schüler Anns plötzlich ein größerer Erzählstrang zuteil wird. Mitunter ist dieses Hinwerfen von Fährten ein wenig frustrierend, da sie in der Regel keine Auflösung erfahren. Aber auch dieses Gefühl scheint gewollt und wird auch dadurch generiert, dass Emily Ruskovich so unglaublich lebendig erzählt. Von allem und jedem würde man gerne noch mehr erfahren.
Auch sprachlich ist „Idaho“ eine ziemliche Wucht. Voller Klarheit und Poesie gleichzeitig, ohne dabei zu gewollt daher zu kommen. Ruskovich, die selber in den Bergen von Idaho aufgewachsen ist, hat viel von ihren Kindheitserinnerungen in die Beschreibung der Lebensumstände einfließen lassen. Dadurch ist „Idaho“ atmosphärisch packend, dicht und realistisch geworden. Ähnlich wie in Emily Fridlunds „Eine Geschichte der Wölfe“ spielt die Landschaft hier eine mindestens genauso große Rolle wie jede der Hauptfiguren. Ebenso wie bei Fridlund liegt eine drückende Schwere über allem, die man bereit sein muss auszuhalten.
Es scheint eine gute Zeit zu sein für Romandebüts von jungen, klugen amerikanischen Frauen. „Idaho“ reiht sich auf jeden Fall mühelos in die spannendsten Erscheinungen des Literaturfrühlings ein.
Info: Emily Ruskovich wuchs im Idaho Panhandle auf dem Hoodoo Mountain auf. Sie ist Absolventin des Iowa Writers’ Workshop, seit Herbst 2017 lehrt sie an der Boise State University. Ihr Debütroman „Idaho“ ist im Hanser Verlag erschienen und kann hier käuflich erworben werden. Eine Leseprobe gibt es hier.
Gelesen von: Gabi Rudolph
